Umbenennungen im Januar
Schlag auf Schlag?
Wer im Januar Nachrichten zu Straßenumbenennungen verfolgt hat, dem muss es so vorgekommen sein, als würde Berlin auf einer Umbenennungswelle surfen. Welche Straßen umbenannt wurden und weshalb die Beschlüsse nicht ganz so plötzlich waren, erfahrt ihr in diesen Artikel.
Tschüss Völkermordstein!
Es begann am 22. Januar mit dem Beschluss der BVV Neukölln den „Hereostein” zu entfernen, der den deutschen Soldaten, die im Krieg gegen die Herero und Nama gefallen sind, gedenkt. (Drs. Nr.: 1609/XXI) Der Stein soll vom jetzigen Standort auf dem Garnisionsfriedhof am Columbiadamm entfernt und in ein Museum gebracht werden, z.B. dem Museum Neukölln oder der Zitadelle Spandau. Auch für die sogenannte “Namibiaplatte“ soll ein neuer Ort gefunden werden.
Am bisherigen Standort soll weiterhin an den Völkermord an den Herero und Nama sowie an die jahrelangen Auseinandersetzungen um die richtige Art des Gedenkens erinnert werden. In den Prozess sollen laut Beschluss Vertreter:innen der betroffenen Communities und Vertreter:innen afrodiasporischer und postkolonialer Gruppen einbezogen und an der Konzeptionierung maßgeblich beteiligt werden.
Der Antrag, der von SPD, Grünen und Linken eingebracht wurde, wurde auch dank ihrer Mehrheit in der BVV Neukölln beschlossen. Die Fraktion der CDU, der AFD sowie der fraktionslose Verordnete stimmten gegen den Antrag.
Wird der Nettelbeckplatz endlich umbenannt?
Nachdem im August 2021 die Umbenennung des Platzes beschlossen wurde, dauerte die Suche nach einem neuen Namen an. Ein diverses Beratungsgremium aus zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen im Wedding hat 2024 aus 530 Namensvorschlägen drei Favoritinnen als mögliche neue Namensgeberinnen erarbeitet: Martha Ndumbe, Vera Heyer und Fasia Jansen. Diese drei Namen wurden im Ausschuss für Weiterbildung und Kultur der BVV Mitte in den letzten Monaten vorgestellt und ausgiebig diskutiert.
In der Januar-Sitzung des Ausschuss für Weiterbildung und Kultur wurde ein Ausschussantrag angenommen, der die BVV Mitte dazu auffordert, die Umbenennung des Nettelbeckplatzes in Martha-Ndumbe-Platz zu beschließen. Bis auf die Bezirksverordneten und Bürgerdeputierten der CDU stimmten alle Mitglieder des Ausschusses dem Antrag zu. In der Januar-Sitzung kam die BVV dieser Aufforderung nach und beschloss den Antrag zur Umbenennung in Martha-Ndumbe-Platz. Die Fraktion der CDU stimmte geschlossen dagegen, konnte jedoch durch die Mehrheit von Grünen, SPD und Linken überstimmt werden. Nun liegt es am Bezirksamt Mitte aktiv zu werden.
Der beschlossene Ausschussantrag fordert das Bezirksamt ebenfalls dazu auf, begleitend zur Umbenennung auf dem Platz eine Informationstafel zu errichten, die den historischen Hintergrund und die Bedeutung des neuen Namens erläutert. Eine offizielle Umbenennung in Martha-Ndumbe-Platz soll noch im ersten Quartal 2025 erfolgen.
Weg mit Treitschke!
Die BVV Steglitz-Zehlendorf hat am Mittwoch, den 22.01.2025, einstimmig für die Umbenennung der Treitschkestraße in Betty-Katz-Straße gestimmt. Selbst die CDU, die sich lange gegen eine Umbenennung gewehrt hatte, votierte dafür.
CDU-Fraktionschef Torsten Hippe erklärte in der Sitzung, dass die CDU weiterhin gegen einen Umbenennung sei. Dennoch sei Betty Katz eine ehrenwerte Straßenpatin.
Heinrich Gotthard von Treitschke (1834–1896) war ein deutscher Historiker, Publizist und Reichstagsabgeordneter, der als einflussreiche Persönlichkeit in politischen und akademischen Kreisen seiner Zeit galt. Besonders durch seine Schriften und Vorlesungen prägte er die öffentliche Meinung und trug erheblich zur Verbreitung antisemitischer Gedanken bei. Seine antisemitische Äußerung 1878 „Die Juden sind unser Unglück.“ wurde später von den Nationalsozialisten aufgegriffen. Mit seinen Schriften trug er dazu bei, dass antisemitische Haltungen auch in gehobeneren Schichten gesellschaftsfähig wurden.
Die Lehrerin Betty Katz (1872-1944) arbeitete als Direktorin des Jüdischen Blindenheims in der Wrangelstraße in Berlin-Steglitz. Hier wohnten und arbeiteten bis zu 50 blinde und auch gehörlose jüdische Frauen und Männer. Alle Bewohner:innen des Blindenheimes mussten am 15. November 1941 zunächst in das sogenannte „Jüdische Blinden- und Taubstummenwohnheim“ in Berlin Weißensee umziehen. Von dort wurden 16 von ihnen am 14. September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Mit ihnen wurde auch Betty Katz deportiert, die am 6. Juni 1944 in Theresienstadt starb. Zu diesem Zeitpunkt waren alle mit ihr gemeinsam deportierten Bewohner:innen des Blindenheimes bereits ermordet worden.
Ausreichend Umbenennungen?
Hier von einer Flut an Umbenennungen zu sprechen ist womöglich etwas zynisch. Wenn man allerdings bedenkt, wie lange diese Beschlüsse meistens auf sich warten lassen, wird dieses Gefühl verständlicher. Bei allen drei Beschlüssen ging ein mehrjähriges zivilgesellschaftliches Engagement voraus. Obwohl bei den Beschlüssen, bezogen auf die Straßen, das Berliner Straßengesetz greift, stellten einige Parteien, insbesondere CDU und AfD, sich immer wieder gegen die Umbenennungen.
Dennoch zeigen die Entwicklungen im Januar, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen dürfen, sondern sind vielmehr motivierend, um sich weiter aktiv für ein dekoloniales und antifaschistisches Stadtbild einzusetzen.




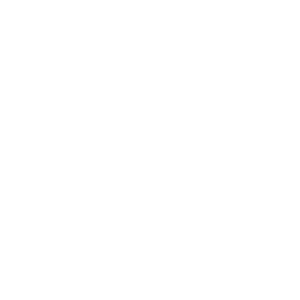
 © 2018 Aschroet
© 2018 Aschroet © Aktives Museum
© Aktives Museum