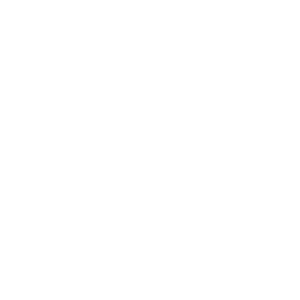Die „Z*mission“ – Oberfeldstr. 146 – Biesdorf
Biesdorf
Die Oberfeldstraße 146 war von 1938 bis 1940 die fünfte und letzte bekannte Adresse der Z*Mission. Das Ziel der Z*Mission der Berliner Stadtmission war es, die Berliner Sinti:zze und Rom:nja zu missionieren. In der Arbeit der Missionar:innen wird wiederholt eine starke antiziganistische Haltung deutlich, die durch verschiedene Publikationen der Mission verbreitet wurde. Es ist nicht bekannt, ob an dieser Adresse aktiv Missionsarbeit mit Sinti:zze und Rom:nja betrieben wurde.
Problematik der Missionsarbeit
Die Missionsarbeit mit den Sinti:zze und Rom:nja zeichnet sich durch defizitorientierte Stereotypen und paternalistische Haltungen aus. In ihrer „Zivilisierungsmission“ setzten sie Strategien des Othering ein, gespickt mit einer Vielzahl von antiziganistischen Vorurteilen und Stereotypen, wie in den Schriften der Missionar:innen deutlich wird. Die erste Missionarin, Maria Knak beschrieb in der Publikation der Berliner Stadtmission von 1910 Sinti:zze und Rom:nja als Menschen die „stehlen und lügen“, „grob, arbeitsscheu und unsittlich, abergläubisch und sehr schmutzig“ sind (Berliner Blätter 1910, 65). Besonders der Aspekt der Arbeit spielte dabei für die Missionar:innen sowohl in den deutschen Kolonien in Afrika als auch in der Heimat eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Missionierung von Sinti:zze, Rom:nja und anderen als „Zigeuner“ betrachteten Gruppen. Diese wurden in beiden Kontexten als arbeitsunwillig und kriminell wahrgenommen.
Schon vor dem 19. Jahrhundert tauchten, ausgehend vom Glauben der Aufklärung an die generelle Erziehbarkeit der Menschheit, Überlegungen zur „Verbesserung der Zigeuner“ in pädagogischen Schriften auf. Der Fokus lag auf den Themen Religion und Arbeit. Dabei wurden vor allem die Kinder der Sinti:zze und Rom:nja als das am leichtesten „formbare“ Element betrachtet, das entscheidend für die Erziehung der gesamten sozialen Gruppe war. So zielte auch die Arbeit der Z*Mission zuerst auf die Kinder ab, wodurch im Verlauf der Zeit auch ein Zugang zu den Erwachsenen ermöglicht wurde. Auf dem Gelände der Z*Mission hatten die Kinder zum Beispiel kleine Gärten, die sie selbst bestellten und so in landwirtschaftliche Arbeitsstrukturen eingeführt wurden. Diese Arbeit sollte sie ebenfalls zur Sesshaftigkeit erziehen. Vom regelmäßigen Gebets- und Bibelunterricht natürlich ganz zu Schweigen.
Nichtsdestotrotz stellte sich die Missionsarbeit der Z*Mission in ihrer Arbeitsmethode damit gegen die Entwicklung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die, angefeuert durch die koloniale Expansion, „Völkern“ feststehende Eigenschaften zuschrieb und basierend darauf eine statische, nicht veränderbare Hierarchie der Völker aufstellte.Dennoch bleibt es nicht aus, dass auch die Missionar:innen „außereuropäischer Völker“ ideologisch zu einem großen Other vermischen, was in einem Bericht des Missionars Kurt Süßkind (1891-1943) von 1931 erschreckend deutlich wird:
„Dann kam der Felix mit einer riesigen, natürlich gekräuselten Buschnegerfrisur. […] Die tiefschwarzen Augen und Haare, die manchmal mehr als dunkelbraune Hautfarbe, die auffällig gekrümmten Nasen, die Kehlkopflaute ihrer Sprache, ihre jüdischen Namen, ihre ans Alte Testament erinnernden Sitten und Gebräuche – alles das bestätigte mir aufs neue die wissenschaftliche Annahme, daß [sic!] die
Zigeunerdie Nachkommen eines uns unbekannten jüdischen Stammes seien.“ (Die Stadtmission 1931, 101-103)
Wenn Sinti:zze und Rom:nja in den Berichten der Missionar:innen als rückständig beschrieben wurden, ging es weniger um ihre eigene (zivilisatorische) Entwicklung, sondern vielmehr darum, dass sie das Evangelium noch nicht erhalten haben. Sobald ihnen dieses aber vermittelt wurde, gäbe es die Möglichkeit zur „Besserung“.
Im Zweiten Weltkrieg gingen viele Unterlagen der Berliner Stadtmission verloren, wodurch die Berichte der Missionar:innen zu einer der wenigen verbleibenden Informationsquellen über die Z*Mission wurden. Die Missionar:innen beschreiben in ihren Berichten unter anderem religiöse Erweckungserlebnisse und dem heilsamen Einfluss von Jesus im täglichen Leben der Kinder und Erwachsenen. Darüber hinaus werden aber auch die Armut, Ausgrenzung, Unterernährung und die daraus resultierenden Krankheiten eingehend thematisiert. Obwohl die Mission auch materielle Unterstützung bietet, liegt der Schwerpunkt auf der religiösen Lehre. Ihr Zugang ist einerseits empathisch und von christlichen Idealen der Nächstenliebe geprägt, jedoch andererseits unweigerlich von antiziganistischen, rassistischenRassismusDer Begriff Rassismus lässt sich als ein Diskriminierungsmuster und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse beschreiben. In modernen Gesellschaften sind es vor allem kulturelle Merkmale, über die Menschen abgewertet und ausgeschlossen werden. Das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Chancen und die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Integration der Betroffenen. wie auch vereinzelt antisemitischen Zuschreibungen bestimmt. Hinzu kommt, dass die Z*Mission von keinen tieferen missionswissenschaftlichen Überlegungen begleitet war. Die Missionar:innen waren meist missionswissenschaftlich unzureichend ausgebildete Christen, die in dem Bewusstsein, dass Gott alle Menschen und somit auch die „Z*“ liebe, soziale und ethnische Grenzen überwanden, um einem göttlichen Missionsbefehl nachzukommen.
Die Missionar:innen der Stadtmission nahmen dabei eine grundsätzlich paternalistische Haltung gegenüber Sinti:zze und Rom:nja ein und betrachteten sie hauptsächlich als zu erziehende Menschen, denen die Botschaft des Herrn verkündet werden musste. Die Darstellung der Sinti:zze und Rom:nja in den Berichten variieren je nach Kontext, Funktion und Adressat:innen. Für die vorliegenden Quellen, die Periodika der Berliner Stadtmission von 1910 bis 1939, geht hervor, dass die Adressat:innen hauptsächlich Unterstützer:innen der Stadtmission, (potentielle) Spender:innen und Interessierte waren. Dementsprechend sind die Berichte über die Weihnachtsfeste stets auch im Dank an die Spender:innen der Geschenke geschrieben. Andere Tätigkeitsberichte über die Arbeit in der Mission enden oft auch mit Spendenaufrufen. Auch wenn die Berichte der Missionar:innen mit ihren Berichten „in kirchlichen Kreisen Ressentiments gegenüber Sinti und Roma abbauen sowie Vorurteile, Plattitüden und inadäquater Stereotypenbildung entgegenwirken“ (Spohn 2013, 238) konnten, perpetuieren sie nichtsdestotrotz damit aus der heutigen Perspektive deutlich schädliche, diskriminierende Vorurteile über Sinti:zze und Rom:nja, die sich bis in die Gegenwart halten. Nicht zuletzt ermöglichte die Arbeit der Missionar:innen, die Listen über die Familien der Sinti:zze und Rom:nja in Berlin führten, den Nationalsozialisten spätestens mit ihrer Machtübernahme einfachen Zugang zu persönlichen Informationen wie Namen und Aufenthaltsorte. Diese Informationen hatten die Ermordung von hunderten Sinti:zze und Rom:nja zufolge.
Fazit: Komplexe Geschichte(n) von Sinti:zze und Rom:nja in Berlin sichtbar machen
Genauso wie der Zeitungsartikel im Gießener Anzeiger 1929 den Eindruck erwecken wollte, die Präsenz von Sinti:zze und Rom:nja in Berlin sei ein neues Phänomen, herrscht auch heute in der Bevölkerung, sowohl in ganz Deutschland als auch in Berlin, wenig Bewusstsein darüber, dass Sinti:zze und Rom:nja schon lange Teil der deutschen Geschichte sind.
Gedenktafeln in der Türkenstraße 21, in der Müllerstraße 100/101, in der Lenaustraße 1-4, in der Glasgower Straße 20a oder in der Oberfeldstraße 146 können das wahrscheinlich nicht grundlegend ändern. Sie könnten jedoch dazu beitragen, diese Leerstellen im stadträumlichen Gedächtnis zu füllen und ein Bewusstsein für die historischen, problematischen und komplexen Interaktionen der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit Sinti:zze und Rom:nja zu schaffen.
Literatur
Berliner Stadtmission: 50 Arbeitsjahre im Dienste des Glaubens und der Liebe. Jubiläumsschrift der Berliner Stadtmission. 1927 Berlin.
Berliner Stadtmission: Blätter aus der Stadtmission/Die Stadtmission, 1910-1922, 1925-1939 Berlin
Bonillo, Marion: „Zigeunerpolitik“ im Deutschen Kaiserreich 1871-1918. 2001 Frankfurt am Main.
Danckwortt, Barbara: „Berlin ohne Zigeuner!“ Das Zwangslager für Sinti und Roma in Marzahn 1936–1945. In: Zeitschrift für Genozidforschung, 2022, Jahrgang 20, Heft 1, S. 37-55.
Dettmer, Claus: Wedding. 1988 Berlin.
Fings, Karola: Sinti und Roma. 2024 München.
Meier, Verena. „Neither bloody persecution nor well intended civilizing missions changed their nature or their number“. A Postcolonial Approach to Protestant „Zigeuner“ Missionary Efforts. In: Critical Romani Studies, 2018, Vol.1 (1), S. 86-112.
Michalsky-Knak, Maria/ Süßkind, Kurt: Zigeuner und was wir mit ihnen in Berlin erlebten. 1935 Berlin.
Milton, Sybil: Sinti and Roma in Twentieth-Century Austria and Germany. In: German Studies Review , May, 2000, Vol. 23, No. 2, S. 317-331.
Nieburg, Richard: Berliner Zigeunerdörfer. In: Gießener Anzeiger. 1929.
Niederhauser, Benjamin: Bei den Berliner-Zigeunern. In: Der Freund der Zigeuner, 1929, 16. Jahrgang, Lausanne.
Pientka, Patricia: Das Zwangslager für Sinti und Roma in Berlin-Marzahn: Alltag, Verfolgung und Deportation. 2013 Berlin.
Pommerening, Christian: Disciplining the In: Fischer-Tahir, Andrea; Wagenhofer, Sophie (Hg.). Disciplinary Spaces. Spatial Control, Forced Assimilation and Narratives of Progress since the 19th Century. 2019 Bielefeld.
Rothberg, Michael: The Implicated Subject: Beyond Victims and Perpetrators. 2019 Stanford.
Said, Edward: Orientalism. 1973 New York City.
Spohn, Elmar: Zwischen Anpassung, Affinität und Resistenz: Eine historische Studie zu evangelischen Glaubens- und Gemeinschaftsmissionen in der Zeit des Nationalsozialismus. 2013 Pretoria.